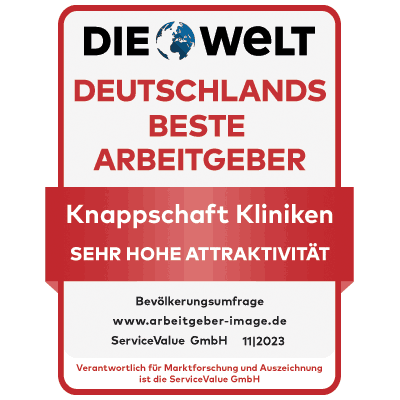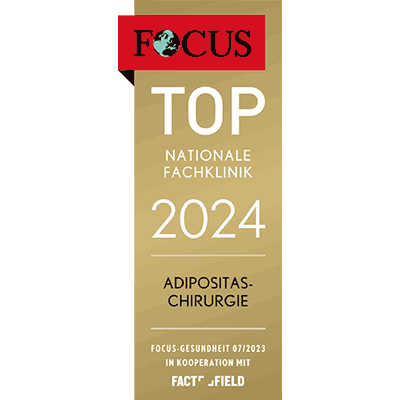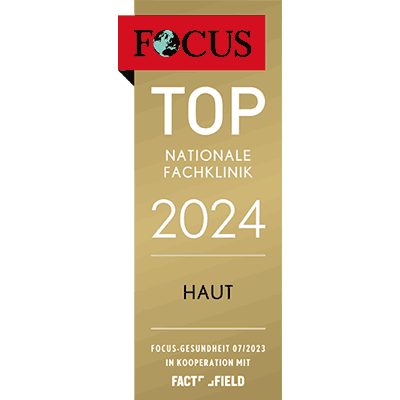Medizinisches Angebot - Knie
Das Kniegelenk ist das größte Gelenk und eine Verbindung aus einem Dreh- und Scharniergelenk, ein sogenanntes Drehwinkelgelenk.
Besteht ein Gelenksverschleiß sind die Knorpelüberzüge meist unwiederbringlich zerstört, so dass Knochen auf Knochen reibt. Dies erklärt auch die mitunter sehr starken, oft auch zyklisch auftretenden Schmerzen.
Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz. Unsere Fachärzte werden Sie bezüglich der operativen und konservativen Behandlungsmethoden ausführlich beraten.
Bei Ihnen wurde durch uns, durch Ihren Hausarzt oder Orthopäden ein Gelenksverschleiß Ihres Kniegelenks erkannt. Sowohl konservative, als auch operative Möglichkeiten stehen zur Verfügung.
Auch wenn eine auf dem Röntgenbild sichtbare Verschleißsituation vorliegt, muss diese nicht zwingend gleich operiert werden. Wenn Sie aber die unten aufgelisteten Fragen überwiegend mit Ja beantworten können, dann ist der Einbau eines künstlichen Kniegelenkes für Sie sehr wahrscheinlich die bessere und auf Dauer auch die schmerzlindernste Option:
1. Leiden Sie unter Anlaufschmerzen?
2. Haben Sie Ruheschmerzen?
3. Werden Sie mitunter nachts durch die Schmerzen wach?
4. Müssen Sie, um die Schmerzen zu ertragen, mehrere Schmerzmittel am Tag einnehmen?
5. Ist Ihre Gehstrecke durch die Schmerzen eingeschränkt?
6. Sind Sie durch die Schmerzen in der Ausübung sozialer Kontakte eingeschränkt?
7. Erleben Sie einen Verlust Ihrer Lebensqualität?


Auch wenn eine auf dem Röntgenbild sichtbare Verschleißsituation vorliegt, muss diese nicht zwingend gleich operiert werden. Wenn Sie aber die unten aufgelisteten Fragen überwiegend mit Ja beantworten können, dann ist der Einbau eines künstlichen Kniegelenkes für Sie sehr wahrscheinlich die bessere und auf Dauer auch die schmerzlindernste Option:
1. Leiden Sie unter Anlaufschmerzen?
2. Haben Sie Ruheschmerzen?
3. Werden Sie mitunter nachts durch die Schmerzen wach?
4. Müssen Sie, um die Schmerzen zu ertragen, mehrere Schmerzmittel am Tag einnehmen?
5. Ist Ihre Gehstrecke durch die Schmerzen eingeschränkt?
6. Sind Sie durch die Schmerzen in der Ausübung sozialer Kontakte eingeschränkt?
7. Erleben Sie einen Verlust Ihrer Lebensqualität?
In jedem Fall empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz, um die oben aufgeführten Fragen und das weitere Vorgehen zu besprechen.


Bei Ihnen wurde durch uns, durch Ihren Hausarzt oder Orthopäden eine Lockerung Ihrer einliegenden Knie-Prothese vermutet oder auch bereits erkannt. Dann sind je nach Befund verschiedene Behandlungsstrategien möglich, zum Beispiel ein Wechsel der sogenannten mobilen Teile, ein einzeitiger Wechsel der Prothese oder auch ein zweizeitiger Wechsel der Prothese.
Welche Behandlung für Sie infrage kommt, muss in Untersuchung durch einen Facharzt abgeklärt werden.
Das vordere Kreuzband besteht aus zwei Bündeln und ist zudem mit einem dünnen Gewebsschlauch umzogen, in dem sich Nervenfasern und kleinere Gefäße befinden.
Es verhindert eine übermäßige Verschiebung der in Verbindung stehenden Gelenksflächen sowohl nach vorne als zu den Seiten hin.
Im Rahmen einer Kreuzbandruptur kommt es meist unmittelbar nach dem Unfall oder dem auslösenden Ereignis zu einem heftigen einschießenden Schmerz im Bereich des Kniegelenks mit möglicher Schwellung und Ergußbildung. Meist sind auch starke Bewegungseinschränkungen die Folge. Nach einigen Tagen klingen sowohl die Schmerzen, als auch die Schwellung in der Regal ab.
Es sind aber auch Teilrupturen möglich. Hierbei ist meist der Gewebeschlauch intakt, aber eines der beiden Bündel teilgerissen oder überdehnt worden. In den Vordergrund können nun im Verlauf Instabilitätsgefühle beim Laufen, Treppensteigen oder nach der Wiederaufnahme der sportlichen Betätigungen sein. Dies kann zu wiederkehrenden Schmerzen und Ergußbildungen des Kniegelenks führen, die insbesondere nach längerer Belastung auftreten können.
Es verhindert eine übermäßige Verschiebung der in Verbindung stehenden Gelenksflächen sowohl nach vorne als zu den Seiten hin.
Im Rahmen einer Kreuzbandruptur kommt es meist unmittelbar nach dem Unfall oder dem auslösenden Ereignis zu einem heftigen einschießenden Schmerz im Bereich des Kniegelenks mit möglicher Schwellung und Ergußbildung. Meist sind auch starke Bewegungseinschränkungen die Folge. Nach einigen Tagen klingen sowohl die Schmerzen, als auch die Schwellung in der Regal ab.
Es sind aber auch Teilrupturen möglich. Hierbei ist meist der Gewebeschlauch intakt, aber eines der beiden Bündel teilgerissen oder überdehnt worden. In den Vordergrund können nun im Verlauf Instabilitätsgefühle beim Laufen, Treppensteigen oder nach der Wiederaufnahme der sportlichen Betätigungen sein. Dies kann zu wiederkehrenden Schmerzen und Ergußbildungen des Kniegelenks führen, die insbesondere nach längerer Belastung auftreten können.
Bei anhaltenden oder zunehmenden Schmerzen, hohem sportlichen Anspruch sowie einem zunehmenden Instabilitätsgefühl ist eine operative Versorgung, um das Risiko einer frühzeitigen Kniearthrose zu vermeiden, zu empfehlen.
Der Innenmeniskus ist fest mit dem Innenband und der Kapsel im Kniegelenk verbunden, was ihn häufig einreißen lässt. Er wird unterteilt in einen vorderen, mittleren und hinteren Abschnitt.
Schädigungen der Menisken sind mit unterschiedlichen Problemen und Schmerzempfindungen verbunden. Diese richten sich am ehesten nach der Verletzungsart sowie der Schädigung des Meniscus.
Bei akuten Verletzungen im Rahmen eines Sportunfalls oder einer Verdrehung des Kniegelenks sind plötzlich starke und auch bewegungseinschränkende Schmerzen möglich. Mitunter besteht auch ein Blockadegefühl, bei der das Kniegelenk nicht mehr selbst- und vollständig durchgestreckt werden kann.
Oftmals kommt es zu einer zusätzlichen Schwellung und Ergußbildung des Kniegelenks, als Zeichen der Schädigung der Kniebinnenstrukturen. Nach akuter Phase können die Schmerzen und die Schwellung im Verlauf abnehmen. Übrig bleiben dann meist aber noch belastungsabhängige Schmerzen, z.B. beim Treppensteigen oder Sport.
Während bei akuten Verletzungen der Schmerz plötzlich auftritt, sind bei chronischen Verletzungen die Schmerzen eher schleichend und im Verlauf zunehmend.
Bei anhaltenden oder zunehmenden Schmerzen sowie einem akuten und nicht mehr zu lösendem Blockadegefühl ist eine operative Versorgung dringend zu empfehlen.
Die Gründe für ein Herausspringen der Kniescheibe (sog. Luxation) sind sehr vielfältig. Es kommt dabei zu einem Abgleiten der Kniescheibe aus der Rinne auf der Oberschenkelrolle. Überwiegend gleitet die Kniescheibe dabei nach außen weg und springt wieder eigenständig in die Rinne zurück.
Bei Patienten mit einer sogenannten patellofemoralen Instabilität kommt es zu einer immer wiederkehrenden Luxation, mitunter sogar mehrmals in der Woche. Hierbei sind oft bestimmte unwesentliche Bewegungsmanöver der immer wieder auslösende Faktor.
Das Herausspringen ist mitunter sehr schmerzhaft. Nach stattgehabter Luxation kann das Kniegelenk stark anschwellen und schmerzen. Es sind auch bewegungsabhängige Schmerzen möglich. Zum Teil vermeiden Patienten aber auch Bewegungen bewusst, aus Angst eine erneute Luxation zu provozieren.
Die Gründe für eine Luxation sowie einer patellofemoralen Instabilität sind sehr unterschiedlich. Häufigste Ursachen sind z.B. angeborene Fehlbildungen der Kniescheibe sowie des Gleitlagers auf der Oberschenkelrolle und vieles mehr.
Bei Patienten mit einer sogenannten patellofemoralen Instabilität kommt es zu einer immer wiederkehrenden Luxation, mitunter sogar mehrmals in der Woche. Hierbei sind oft bestimmte unwesentliche Bewegungsmanöver der immer wieder auslösende Faktor.
Das Herausspringen ist mitunter sehr schmerzhaft. Nach stattgehabter Luxation kann das Kniegelenk stark anschwellen und schmerzen. Es sind auch bewegungsabhängige Schmerzen möglich. Zum Teil vermeiden Patienten aber auch Bewegungen bewusst, aus Angst eine erneute Luxation zu provozieren.
Die Gründe für eine Luxation sowie einer patellofemoralen Instabilität sind sehr unterschiedlich. Häufigste Ursachen sind z.B. angeborene Fehlbildungen der Kniescheibe sowie des Gleitlagers auf der Oberschenkelrolle und vieles mehr.
Auch wenn vor einer Operation konservative Maßnahmen durchgeführt werden können und diese mitunter auch sinnvoll sind, können diese nicht das ursächliche Problem beseitigen. Wenn also Ihre Beschwerden nach intensivierter konservativer Therapie sich nicht bessern oder eine schnelle Verschlechterung auftritt, empfiehlt sich eine operative Versorgung der patellofemoralen Instabilität.